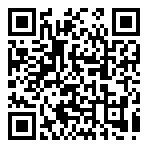No-Hate-Parade in Rathenow
Hier der Entwurf einer Rede eines Mitwirkenden zur Orientierung:
Meine Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde der Kunst,
wir leben in einer Zeit, die lauter geworden ist.
Schneller. Härter.
In der Schlagworte oft mehr zählen als Argumente.
In der Unterschiede betont werden – und das Gemeinsame oft übersehen wird.
Und genau in dieser Zeit gewinnt etwas an Bedeutung, das nicht laut ist.
Etwas, das nicht schreit, nicht verurteilt, nicht spaltet.
Etwas, das leise ist – und gerade deshalb so stark:
Die Kunst.
Kunst ist keine Antwort auf alles –
aber sie ist eine Einladung zum Nachdenken.
Sie kann nicht heilen, was kaputt ist –
aber sie kann zeigen, wo der Riss durch uns geht.
Kunst fragt nicht nach Parteibuch, Herkunft oder Marktwert.
Sie fragt:
Was bewegt dich?
Was macht dich menschlich?
Was trennt uns – und was verbindet uns?
Und gerade deshalb möchte ich heute – im Namen der Kunst – werben:
Für ein menschliches Miteinander.
Für eine Gesellschaft, die zuhört, statt zu urteilen.
Die fragt, statt zu verurteilen.
Die verbindet, wo andere trennen.
Lassen Sie mich dabei eines ganz klar sagen:
Wenn ich heute über Begriffe wie Antifaschismus oder Antikapitalismus spreche,
dann nicht im Sinne einer parteipolitischen Haltung.
Ich spreche nicht als Parteigänger,
sondern als Mensch,
als Kulturschaffender,
als jemand, der an die Kraft des Gemeinsamen glaubt.
Antifaschismus ist für mich kein ideologisches Etikett,
sondern ein ethisches Minimum:
Das klare Bekenntnis zu Menschenwürde, Erinnerung und Empathie.
Und wenn ich von Antikapitalismus spreche,
dann meine ich keine pauschale Ablehnung von Wirtschaft,
sondern die kritische Reflexion eines Systems,
in dem der Mensch oft zur Zahl wird, zur Ware, zum Produktionsfaktor.
Kunst kann und darf nicht neutral sein, wenn es um Menschenwürde geht.
Sie ist nicht parteipolitisch – aber sie ist politisch im tiefsten Sinne:
Sie stellt Fragen, wo andere schweigen.
Sie widerspricht, wo andere schweigen.
Sie erinnert, wo andere verdrängen.
Und noch etwas trägt uns, oft unausgesprochen, durch Zeiten der Unsicherheit:
Glaube.
Nicht zwangsläufig religiös –
aber immer eine innere Kraft.
Ein Vertrauen, dass das Leben mehr ist als das Sichtbare.
Ein Ahnen, dass Würde, Gerechtigkeit und Liebe nicht verhandelbar sind.
Ein Glaube daran, dass der Mensch mehr ist als das, was er leistet.
Mehr als das, was er besitzt.
Glaube – in welcher Form auch immer – erinnert uns an Demut.
An Verantwortung.
An die Möglichkeit von Versöhnung.
Und auch hier wird die Kunst zum Ausdruck dieses Glaubens:
In Bildern, in Klängen, in Worten, die uns erheben, trösten, herausfordern.
Sie schafft Räume, in denen Menschen mit und ohne Religion
einander begegnen können – im Staunen, im Fragen, im Schweigen.
Glaube verbindet – wenn er nicht grenzt.
Und Kunst kann dieser Glaube sein:
an das Gute, das Unzerstörbare, das Menschliche im Menschen.
Wir leben in einer Zeit, in der Parolen wieder laut werden.
In der Ausgrenzung wieder als „die richtige Meinung“ getarnt wird.
In der Geschichte relativiert wird – und Sprache missbraucht.
Faschismus beginnt nicht erst mit Gewalt.
Er beginnt mit Entmenschlichung.
Mit einem „Die gehören nicht zu uns“.
Mit einem „Die sind weniger wert“.
Und er endet – das haben wir gelernt – in Unrecht, Verfolgung, Zerstörung.
Deshalb ist Antifaschismus kein Sonderstandpunkt,
sondern eine demokratische Selbstverständlichkeit.
Ein Nein zum Hass –
und ein Ja zum Leben.
Und wer, wenn nicht die Kunst, soll das erzählen?
Die Bilder, die Klänge, die Gedichte – sie bewahren das,
was nicht vergessen werden darf.
Doch es ist nicht nur der offene Hass, der spaltet.
Auch ein entgrenzter Kapitalismus trägt Verantwortung.
Ein System, in dem alles zur Ware wird:
Zeit, Raum, sogar der Mensch selbst.
Wenn Bildung zur Dienstleistung wird,
wenn Kunst sich rechnen muss,
wenn Wohnen zum Luxus wird –
dann wird die Frage unausweichlich:
Was ist uns der Mensch noch wert?
Antikapitalismus – so wie ich ihn hier verstehe –
heißt nicht: alles abschaffen.
Sondern: alles neu bewerten.
Vom Menschen aus denken. Vom Gemeinwohl her gestalten.
Nicht vom Markt, nicht von der Bilanz.
Und auch hier kann Kunst ein Gegenbild entwerfen:
Sie fragt nicht nach Verwertbarkeit.
Sie fragt nach Wahrheit.
Nach Schmerz.
Nach Sinn.
Wenn ein Lied eine Träne auslöst – auch wenn man die Sprache nicht versteht.
Wenn ein Bild mich verstört – weil es etwas zeigt, das ich längst vergessen wollte.
Wenn ein Theaterstück Fremdes nah macht –
dann beginnt Begegnung.
Dann beginnt Menschlichkeit.
Kunst ist nicht dazu da, zu gefallen.
Sondern zu bewegen.
Nicht zu glätten.
Sondern zu zeigen, wo es wehtut.
Sie ist – und das ist ihr größter Wert –
ein Ort, an dem wir uns als Menschen begegnen.
Nicht als Konsumenten.
Nicht als Bürger eines Landes.
Nicht als Vertreter einer Meinung.
Sondern als fühlende, suchende, verletzliche, schöpferische Wesen.
Wenn wir als Gesellschaft überleben wollen,
müssen wir neu lernen zu sehen.
Zu hören.
Zu fühlen.
Und genau das lehrt uns die Kunst.
In einer Welt, die oft nur den Preis kennt –
zeigt sie uns den Wert.
Lasst uns ihr zuhören.
Lasst uns einander zuhören.
Nicht im Namen einer Partei,
sondern im Namen der Würde.
Nicht für eine Ideologie,
sondern für das, was uns alle betrifft:
Freiheit. Gerechtigkeit. Mitgefühl.
Und – ganz gleich ob mit Religion oder ohne –
Glaube an das Gute.
Für ein menschliches, antifaschistisches, antikapitalistisches –
und vor allem: hoffnungsvolles Miteinander.
Ich danke Ihnen.